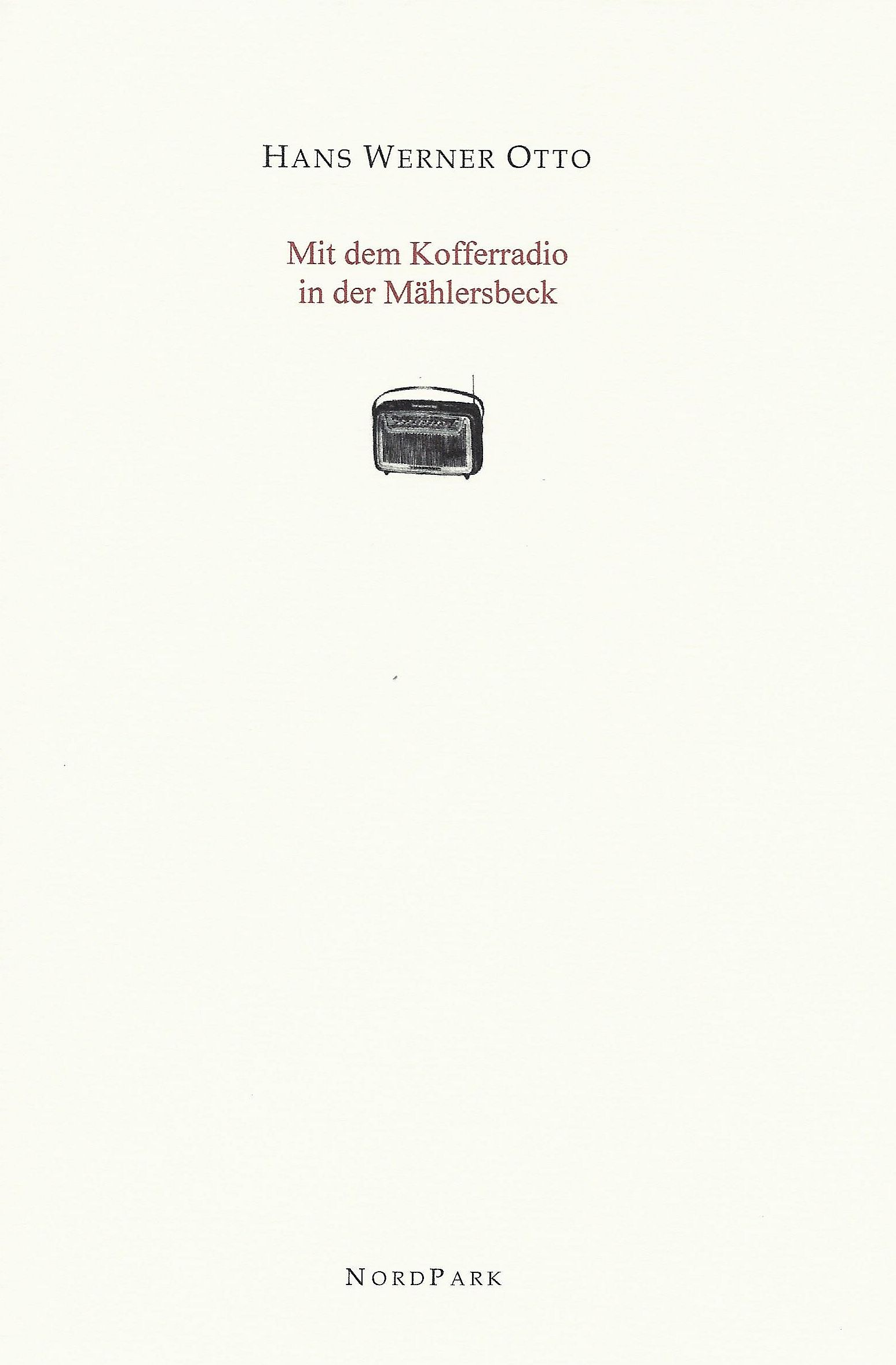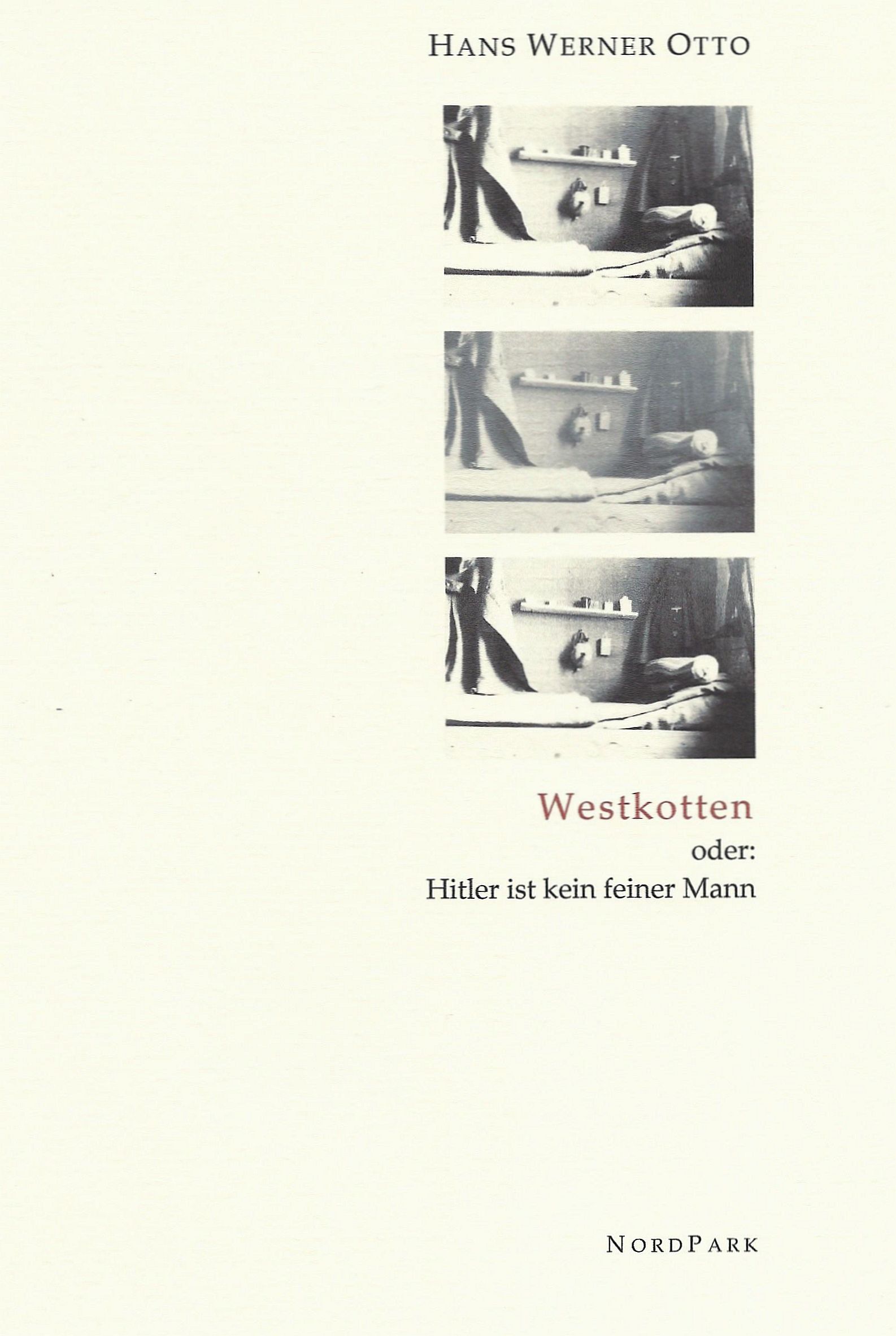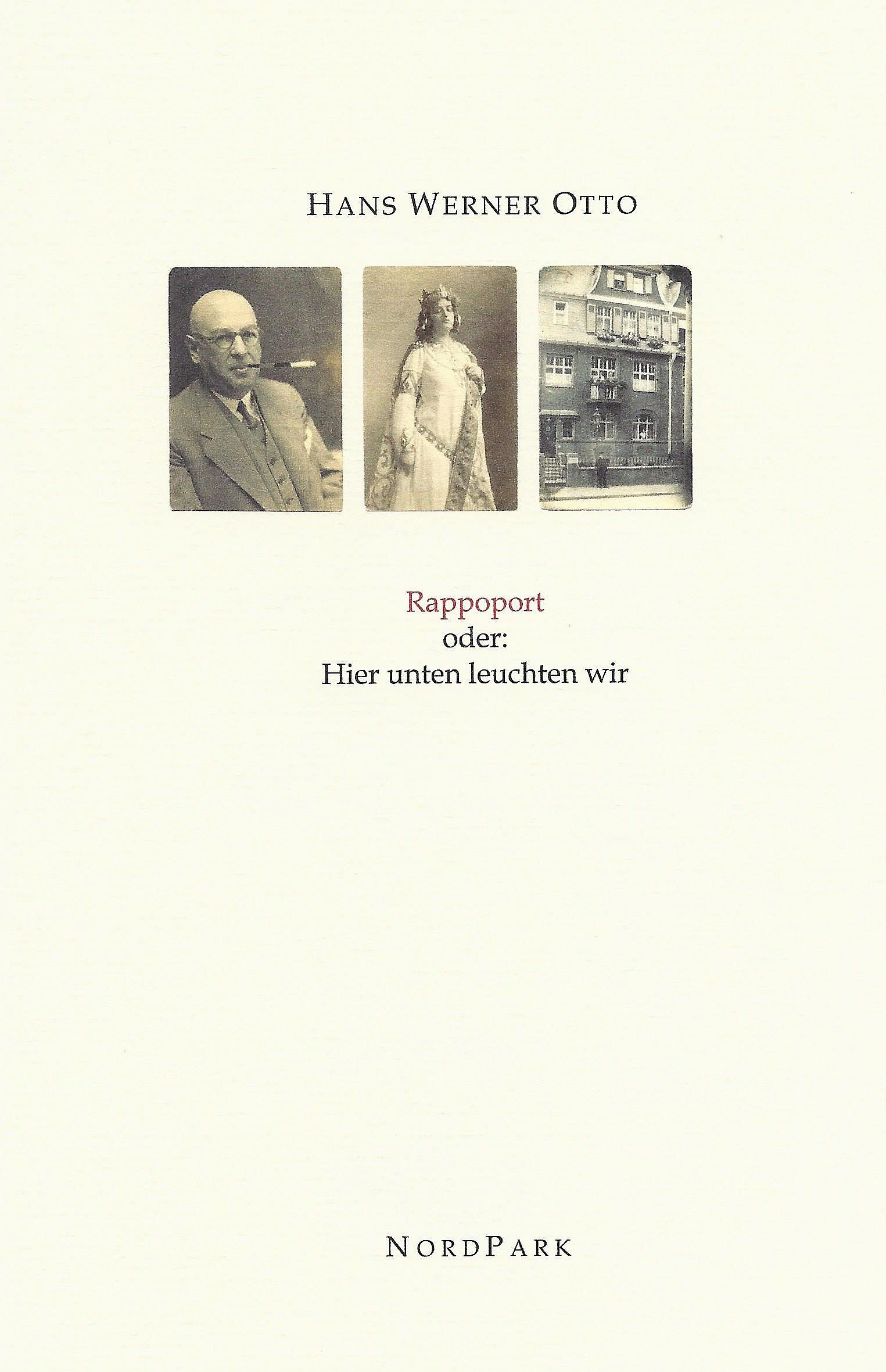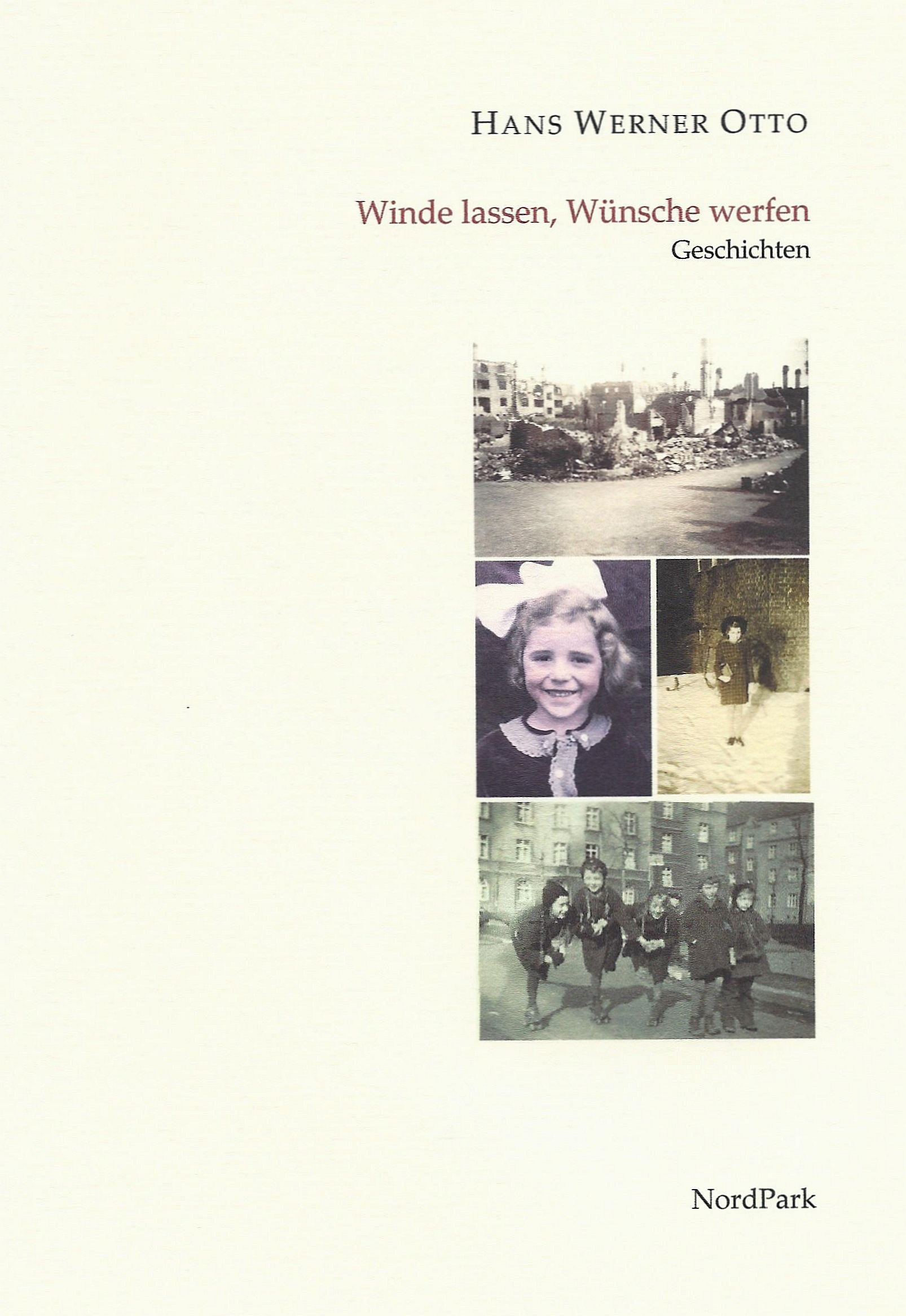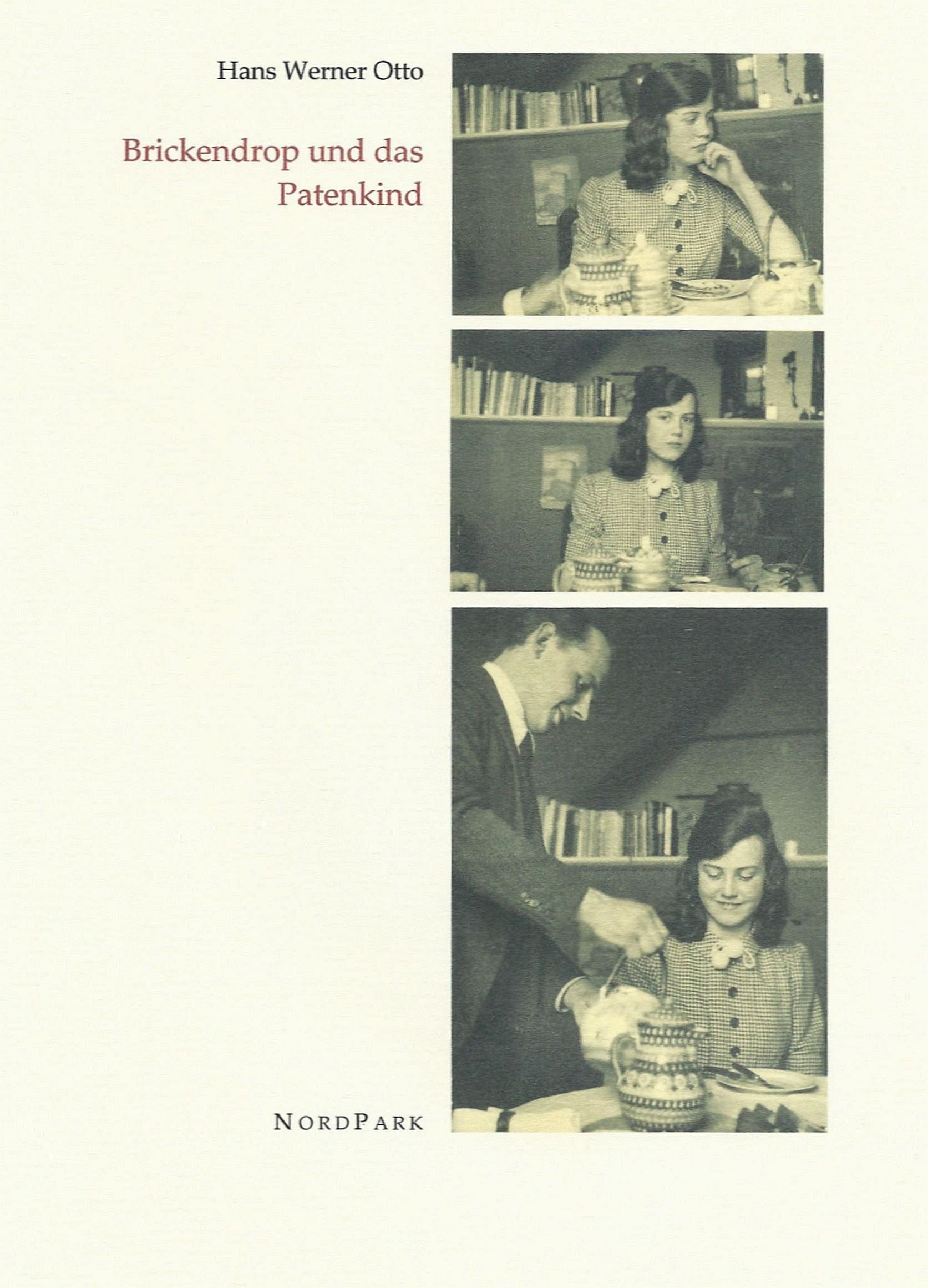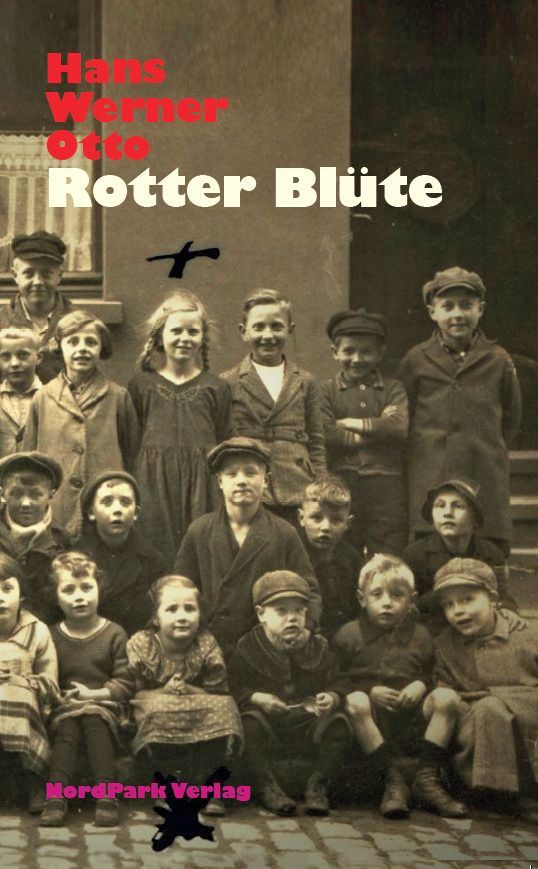N O R D P A R K
 V E R L A G |

Otto, Hans-Werner:
Gott wird uns schon nicht kriegen.
Roman.
252 S.; 2010; EUR 16,00;
ISBN: 978-3-935421-65-2


bestellen
Leseprobe
In den Siebzigern waren wir vaterlose Gesellen
Die Väter hingen als Fotos an der Wand oder lagen unter Autos herum, aber so richtig da waren sie eigentlich nicht.
»Gott wird uns schon nicht kriegen« erzählt von Vätern und Söhnen, vom Erwachsenwerden in den siebziger Jahren, vom Freund, der plötzlich verschwindet, und von den Freunden, die er zurücklässt. Hans Werner Otto unverwechselbarer Sprachstrom diesmal nicht in kurzen Erzählungen, sondern in einem schwebenden und fesselnden Roman über eine Stadt, eine Zeit und junge Menschen, die sich zurechtzufinden versuchen in einer sich neu bildenden Gesellschaft.
Ein Buch über Männer und Frauen, über die Liebe und ihre Flüchtigkeit und ihre Beständigkeit, über Freundschaft und Flucht, über das Suchen und Gefundenwerden, von einem Erzähler, dessen Sprachmelodie verzaubert.
Man konnte Jesus an der Art erkennen, wie er das Brot brach?
Brot wird geschnitten, nicht gebrochen. Höchstens Knäckebrot oder Zwieback.
Und wie soll man mit jemandem reden, auf dem man herumkaut?
Trotzdem versuchte ich es. Aber dann wusste ich nie so recht, mit wem, ob nur mit Jesus oder auch Gottvater oder dem Heiligen Geist oder allen dreien zugleich. Die drei antworteten nie. Keiner von ihnen. Nicht mal Jesus, der doch wohl Mensch war und das eigentlich können müsste. Er lässt uns reden und reden und sagt nie selbst was. Nur Don Camillo, dem sagte er was.
Mir sagte er nichts.
Leseprobe:
In den Siebzigern waren wir vaterlose Gesellen.
Nicht Petra und ich, wir Männer, meine ich. Wir Jungmänner.
Wir Lehrlinge und Oberstufenschüler, wir Handballspieler
und Plattenspieler und Zigarettenraucher und Biertrinker. Wenn
wir zusammen hockten, gab es Handballspiele, Schallplatten,
Zigaretten und Bier, aber keine Väter.
Jürgen und Gerd redeten ab und zu über ihre Mutter, aber
nie über ihren Vater, und als ich sie einmal besuchte, fragte
ich sie nachher, wer denn der Mann gewesen sei, der mal kurz
hereingeschaut hatte. Ihr Vater? Ich hatte immer gedacht, den
gäbe es gar nicht.
Karls Vater war nur halb da, er hatte im Krieg eine Kugel in
die Wange bekommen, das ganze Gesicht war eine große Narbe,
die eine Hälfte immer ernst und bedrohlich, während die andere
sprach und manchmal sogar lächelte. Aber der entstellte Mund
formte nur schwer verständliche Worte, mit ihm zu reden war
schwierig, und dieses halbe Lächeln war keines, dem man sich
so schnell anschließen mochte.
Michaels Vater dagegen lächelte ganz breit auf dem großen
Schwarz-Weiß-Foto, das in der Wohnküche über dem Sofa hing
und von Blümchentapete umrahmt wurde. Michaels Vater war
ja auch schon tot.
Bei Rainer war die Mutter tot, der Vater lebte noch, aber den
sahen wir nie. Nur einmal, als wir bei Rainer feiern durften,
da kam er gegen zwölf rein, drehte die Musik leiser, so dass
Pärchen aufhörten zu knutschen, und fing schon mal damit an
die Aschenbecher zu leeren; da wussten wir, dass die Feier zu
Ende war.
Hans-Walters Vater war Lehrer, er war zwar meist zu Hause,
wenn wir Hans-Walter besuchten, und vielleicht hätte er sogar
mit uns geredet, aber wir wollten ihn gar nicht sehen. Wir drückten
uns auf dem Weg nach draußen an seinem Arbeitszimmer
vorbei und achteten auch im Garten dann darauf, dass wir
nicht zu laut wurden, wenn wir in die mächtige Trauerweide
kletterten. Wir wollten ihn nicht auf uns aufmerksam machen,
einen Lehrer, man hätte ja überhaupt nicht gewusst, wie man mit
so einem außerhalb des Unterrichts umgehen sollte. Wir saßen
auf den dicken Ästen wie früher, als wir noch Kinder gewesen
waren; statt die hängenden Zweige als Lianen zu benutzen,
bliesen wir unseren Zigarettenrauch hinein und redeten, zum
Beispiel über dieses lästige Abitur.
Klaus hatte auch einen Vater. Er war aber nie da. Die Mutter
schon, sie war neugierig und freundlich und stellte uns auch
schon mal ein Bier hin. Der Vater war nirgendwo, auch nicht als
Foto. Einmal nur sah ich seine Füße, da gingen wir gerade aus
dem Haus, Klaus und ich, und Klaus rief etwas in die Garage
hinein, um sich zu verabschieden. Als eine Stimme von da antwortete,
wo ich eigentlich nur ein Auto sah, guckte ich genauer
hin und entdeckte dann die Füße von Klaus’ Vater unter dem
blauen Ford Mustang. Braune Halbschuhe, graue Socken mit
gelben Rauten und zwei helle Streifen stacheliger Waden.
Und Bernhards Vater? Bernhard sagte, über den wolle er
nicht reden.
Die Siebziger begannen, und Väter hingen als Fotos an der
Wand oder lagen unter Autos herum, aber so richtig da waren
sie eigentlich nicht. Meiner auch nicht, er baute nach Feierabend
und am Wochenende das neue Haus.
Er bat mich nur selten, mitzuhelfen, er nahm Rücksicht auf
mein Abitur, das gerade bevorstand und genau so gefährdet
schien wie die Versetzungen in all den letzten Jahren. Und wenn
ich dann mithalf, hatte er kaum Zeit, mich anzulernen – das
kam später, viel später. Er gab mir eine einfache Arbeit, ich
stapelte Steine, fuhr Schubkarren, bediente die Mischmaschine.
Ich sah fasziniert auf die frisch gegossene Bodenplatte und die
vier Steine darauf, die er mir hingelegt hatte, um die Abgrenzung
meines Zimmers zu markieren. Ein Zimmer, das ich nur sehr
kurze Zeit bewohnen würde, so viel war mir schon klar. Es erschien
winzig, aber es würde mein erstes eigenes Zimmer sein.
Ich schaufelte Sand in die Mischmaschine und dachte nur ab
und zu ans Abitur. Mehr an mein Zimmer. Und an Mädchen.
Die, übrigens, hatten Väter.
Zum Beispiel Petra. Wenn ich sie besuchte, musste ich meist
noch kurz ihre Eltern begrüßen, das gehörte sich so. Die Mutter
in der Küche hörte Radio und gab mir nicht die Hand,
entschuldige bitte, denn die war noch nass vom Spülwasser.
Aber der Vater im Wohnzimmer bot mir direkt einen Sessel
ihm gegenüber an. Er las unter der Stehlampe in einem dicken
Buch, auf dem Couchtisch waren Karten ausgebreitet: Russland,
Frontlinien, mit Buntstiften dezent koloriert, Vorstöße
und Rückzüge. Daneben ein Stövchen mit einer Kanne Tee und
einer Flasche Weinbrand, von der er jeder neuen Tasse Tee immer
einen Schuss verpasste. Petras Vater wusste, dass ich mich
für Geschichte interessiere, er wusste auch, dass ich mich für
seine Tochter interessierte, und so nutzte er schamlos die Situation
aus, erzählte viel von Russland und vom Krieg, von Gewaltmärschen
und seinen erfrorenen Zehen. Ich versuchte ihm
zuzuhören, was ziemlich schwierig war: er nuschelte und die
Straßenbahn vor der Haustür quietschte im Fünfminutentakt
durch noch nicht doppelverglaste Fensterscheiben ins Wohnzimmer
hinein, also verstand ich manchmal gar nicht, was er
sagte. Aber ich mochte ihn und genoss den warmen Schein der
Stehlampe, die sein sauber gescheiteltes, glatt gekämmtes volles
Haar beleuchtete, genoss den Duft von schwarzem Tee, der rot
aus der Glaskanne leuchtete, den Duft des Cognacs und den
Blick der dunklen Augen Petras, die um Verzeihung baten für
den genuschelten Redeschwall des Vaters und gleichzeitig viel
von dem versprachen, wofür das Einzelbett in ihrem Zimmer
nebenan viel zu schmal war. Ihr Vater schien das nicht zu ahnen
und redete weiter, während ihr Blick irgendwann dringlicher
wurde und wir eine Möglichkeit des Absprungs suchten, eine
längere Atempause, in der er sich wieder neu Tee und Cognac
einschenkte, die Beendigung eines Vorstoßes oder Rückzuges
auf russischem Boden oder die willkommene Unterbrechung
durch die Mutter, die mit trockenen Händen aus der Küche
ins Wohnzimmer trat und irgendeine Bemerkung machte, die
überhaupt nichts mit Russland, mit Vorstößen oder Rückzügen
zu tun hatte, eher mit Wetteraussichten aus dem Radio oder
der Krankheit einer Nachbarin.
Irgendwie hatte Petra für mich auch dann noch einen Vater,
wenn wir uns anschließend nebenan auf dem schmalen Bett
herumdrückten, das zu einer Couch zusammengeklappt noch
weniger hermachte. Sie selbst schien das nicht so zu empfinden,
Tür zu, Bett aufgeklappt, aber ich hatte da so meine Hemmungen.
Ihr Vater würde bestimmt nicht hereinkommen, und
abgeschlossen war auch. Trotzdem. Immerhin saß er Luftlinie
nur etwa vier Meter entfernt im Sessel beim Cognactee und
las im dicken Russlandbuch, und vielleicht schob er ja gerade
jetzt, in diesem Augenblick, die Brille in die Stirn, seufzte und
sah durch die Wand hindurch genau auf die Stelle, wo meine
rechte Hand lag.
Solche Väter sahen ja alles.
Damals: Petra und ich, also.
Damals: kam es uns, wenigstens in diesem einen langen Jahr,
so vor, als würden wir uns niemals trennen. Ein paar Tage ohne
einander waren schon schwierig. Und erst mal die Sommerferien,
wenn ich drei Wochen lang auf Interrail-Tour sein würde
und sie mit ihren Eltern im Schwarzwald, das war kaum auszuhalten,
man würde sich ja fast fremd werden.
Aber unser Jahr war schon vor den Sommerferien um. Die
Trennung war heftig und traurig und dauerte drei Tage, und ich
kann mich überhaupt nicht mehr an den Grund erinnern. Kam
da plötzlich jemand anderes ins Spiel? Möglich. Aber wer?
Jetzt war ihr Vater gestorben.
Ich nahm den Arm von ihrer Schulter, sie sah weg von den
Backmischungen und mir ins Gesicht.
»Es hat mich wirklich gefreut, dich mal wieder gesehen zu
haben. Ehrlich.«
Blickte dabei mit ihren kurzsichtigen Augen mitten in meine
hinein, nachdrücklich. Nahm den Einkaufswagen und rollte
los, Richtung Kasse.
Ich sah ihr einen Moment nach, schlenderte dann ein wenig
durch die Fischkonservenabteilung und suchte die Ölsardinen,
lief aber auf einmal ganz schnell wieder zurück zum Obst, griff
mir das Pflaumenglas, drückte mich an einer kleinen Schlange
vor der Kasse vorbei zu Petras rollenden Einkäufen und schaffte
es gerade noch, das Glas aufs Band zu stellen, bevor die Kassiererin
die Summentaste drückte.
Petra sah mich dankbar an, sagte nichts, drückte mir aber
einen schnellen Kuss auf die Wange.
Immerhin.
Dann fragte sie mich, was denn eigentlich aus Bernhard geworden
sei.
Ich auch.

Ein Haus, das war alles.
Mein Vater also baute das Haus für unsere Familie. In dem
ich mein winziges Zimmer bekam, mein erstes eigenes Zimmer.
Das war es, was ich brauchte: ein Zimmer.
Aber wir: Bernhard, Ute, Karl, Sabine, Rainer, Margot, Jürgen,
Gerd, ja sogar Petra und noch ein paar andere, insgesamt waren
wir wohl etwa zwanzig Leute, wir brauchten mehr als nur ein
Zimmer. Wir waren viele, wir waren ziemlich ausgewachsen
und wir brauchten Platz. Room to move.
Also bauten wir uns auch ein Haus. Und wenn Bernhard
nicht verschwunden wäre, dann hätten wir es vielleicht immer
noch. Heute noch? Möglich.
Das heißt, eigentlich bauten wir es nicht, denn es stand ja
schon. Aber wir renovierten so gut wir konnten. Wir hatten es
für zweihundertfünfzig Mark gemietet und mussten mächtig
zusammenlegen, um das Geld jeden Monat aufzubringen. Wir
wohnten nicht drin, sondern trafen uns dort, und das fast täglich.
Zu dem Zweck hatten wir es auch gemietet.
Die Idee kam uns im Impuls. Bernhard, Gerd und ich saßen
in dieser Kneipe mit Bühne, wo gerade mal kein Jazzkonzert
stattfand, tranken jeder ein Bier, mitten unter berühmten
Free-Jazzern und interessant und schön verrucht aussehenden
Menschen, die allerdings alle so etwa fünf bis zehn Jahre älter
waren als wir. Und die sich alle mehr als ein, zwei Bier leisten
konnten. Bei uns war meist nach einem Bier Sense. Nicht, dass
das Impuls überhöhte Preise gehabt hätte, wir hatten einfach
keine Kohle.
»Man müsste irgendwo einen Raum mieten, ein paar Kästen
Bier kaufen, dann könnte man sich da treffen.« Das war
Gerd. Er meinte natürlich nicht nur Bernhard, Gerd und mich,
sondern uns alle. Wie gesagt, so um die zwanzig Leute. Messdiener,
Dänemark-Jugendfreizeitler, Interrailer, Handballspieler,
Abiturienten, Lehrlinge und Erstsemester, große Brüder, kleine
Schwestern, Abschlussballtanzpartner, Kneipenbekanntschaften,
Klassenkameraden, Freunde und Freundinnen von irgendwem.
Und bislang trafen wir uns immer gerade bei dem, dessen Eltern
nicht da waren. Oder dessen Eltern es nichts ausmachte, dass
wir nebenan mit den Cream »Sunshine of your love« sangen
und die Bude vollqualmten.
Und in Kneipen, in Unterbarmen zum Beispiel, am Loh, bei
Bernd. Seine Kneipe war etwa wohnzimmergroß, er verdiente
viel Geld an uns, aber wenn er uns leid war und wir immer noch
nicht gehen wollten, holte er den Gartenschlauch und spritzte
uns mitsamt Dreck, Schokoladenpapier, Zigarettenkippen und
Kronkorken einfach hinaus auf die Straße. Wir trafen uns bei
ihm und versuchten die Musik zu übertönen, oft gewann die
Musik und wir kapitulierten, sangen dann einfach mit, bestellten
Bier und ließen uns schließlich hinausspritzen.
In so einem angemieteten Raum könne man dann auch noch
mehr machen, sagte Gerd. Nicht nur sich einfach zuschütten
und Lieder mitgrölen, die dir aus den Boxen um die Ohren
dröhnten und dir manchmal noch nicht mal gefielen.
»Was denn?«, fragten Bernhard und ich, »Was kann man da
noch so alles machen?«
Wusste Gerd jetzt auch nicht sofort. Aber so ein Raum, das
wäre es doch, oder?
Natürlich, er hatte Recht.
Brauchte ja auch nicht groß zu sein. Ein Kellerraum, eine
Garage, etwas in der Art.
Und dann bekamen wir ein ganzes Haus, sogar ziemlich
schnell.
Denn noch während ich den Zettel mit der Suchmeldung
an das studentische schwarze Brett pinnte, sah mir ein älteres
Semester über die Schulter, ein weibliches älteres Semester. Eine
ihrer großen Brüste berührte mich an meiner rechten Rückenhälfte.
Für eine Studentin war sie sehr elegant, roch aber nach
dem Heringsstipp, den es gerade in der Mensa gegeben hatte,
und sie sagte mit einer angenehm tiefen Stimme, da wisse sie
was für mich. Eine ehemalige kleine Fabrik im Osten Wuppertals,
war wohl mal eine Bandwirkerei gewesen, dann von einem
Künstler als Atelier genutzt worden, sei nicht so richtig gut in
Schuss, die letzten Mieter seien gerade rausgeklagt worden und
hätten ziemliches Chaos hinterlassen. Das Ding stünde aber
gerade leer und sei eigentlich auch überhaupt nicht teuer.
Und kurz darauf hatten wir dann die Bude am Hals.
Ich glaube, es war hier, in dem kleinen Fabrikgebäude, das
wir kurz darauf großspurig Kommunikationszentrum nannten,
wo Bernhard jetzt kein anderer mehr sein wollte. Es war ihm
offenbar auf einmal ganz gleichgültig, wer er war, er wollte
es gar nicht mehr wissen, er war ja so viel auf einmal und es
machte ihm gar nichts aus. Da war ein Schalter in seinem Kopf
umgedreht worden.
Er legte sich mächtig ins Zeug, bestellte erst mal für uns alle
einen Container, damit wir all das aus dem Haus bekamen, was
wir nicht mehr gebrauchen konnten. Das war ne ganze Menge,
in der Hauptsache kaputte Schränke und angeschimmelte Polstermöbel,
aber mittendrin ein altes Harmonium, das behielten
wir. Die dicken Vierkantbalken, die wir fanden, behielten wir
auch und zimmerten einen grobschlächtigen Tresen zusammen,
der stand dann schon, als die Wände noch nicht gestrichen waren.
Und Bernhard stand dahinter, reichte Karl die Bierflaschen
zum Öffnen. Karl biss zu und spuckte die Kronkorken in ein
altes Fischernetz, das Sabine über den Tresen gespannt hatte.
Bernhard kassierte eine Mark pro Flasche, verwaltete die Getränkekasse
und sagte, sobald wir die Flaschen leer hatten, die
Mittagspause sei jetzt zu Ende. Wir machten irgendeine blöde
Bemerkung, waren ihm aber ganz dankbar und griffen wieder
zu Spachtel und Gips, Pinsel, Rolle und Farbeimer.
Ich kannte ihn kaum wieder. Der Bernhard, der so gemächlich
Pfeife rauchte, meist lange nachdachte, bevor er irgendwas
Wichtiges sagte, derselbe Bernhard sprudelte jetzt los und
versprühte jede Menge Ideen, wenn es um unser Haus ging, er
wirbelte und schäumte und lachte und machte sich mit zusammengekniffenen
Augen und runzliger Stirn ganz tiefe Sorgen
um irgendwelche technischen Probleme.
»Es geht mir einfach gut, verstehst du«, sagte er, als ich ihn
auf sein Gesicht ansprach, und sofort war er wieder bei der
Frage, ob man bei der Wand, die wir auf der kleinen Empore
über dem Tresen ziehen wollten, den Gipskarton einfach oder
doppelt anbringen sollten. Oder ob wir den zweiten Raum vorne
wirklich orange und blau streichen sollten, das sind ja Komplementärfarben,
da kannte er sich jetzt aus als Erstsemester in
Graphik/Design. Und er leitete die Vollversammlungen. Dieser
Bernhard, der sonst immer nur spöttische und ziemlich witzige
Bemerkungen abließ, wenn sich jemand hervortat, der tat sich
jetzt selbst hervor, vielleicht ließ jetzt ein anderer spöttische und
witzige Bemerkungen über ihn ab, möglicherweise, aber das
kratzte ihn nicht. Er nahm die Sache in die Hand, er schmiss
den Laden jeden Mittwochabend zur Vollversammlung, wenn
alle sich voll versammelten, im großen Raum zwischen Tresen
und Bühne auf Matratzen und leeren Bierkästen hockten, die
Kronkorken der Bierflaschen ins Fischernetz warfen und rauchten,
was das Zeug hielt.
Erst gab es den Kassenbericht, das machte Gerd, er war der
Finanzminister. Meist hatte jemand Belege für Farbe, Gips, Dübel
vergessen oder seinen Monatsbeitrag noch nicht bezahlt, und
Gerd war beleidigt, er musste ja die Miete zusammen kriegen.
Dann ging es um den Arbeitseinsatz am nächsten Wochenende.
Eine Ecke im Raum vorne links musste noch verputzt werden,
das wollte Karl erledigen. Der Kamin sah schlimm aus, schief
und krumm, was man denn da machen könne. Ich versprach,
mein Vater würde kommen und sich ihn ansehen. Anschließend
wurden die nächsten Projekte besprochen. Bernhard hatte viele
Projekte.
»Zunächst müssen wir mal mit den Nachbarn klarkommen«,
sagte er einmal. Das war in einer der ersten Wochen.
Die Nachbarn, das waren die Bewohner der Häuser zur
Straße hin, unser Haus lag dahinter, war also ein Hinterhaus,
und wir mussten immer durch eine Löv des Vorderhauses. Die
Nachbarn, das waren die Leute, die unweigerlich etwas von
uns und natürlich auch unserer Musik mitbekamen. Leute, die
nachmittags mit Kissen unter den Ellbogen im Fenster hockten
und unser Treiben beobachteten, die abends in Ruhe den »Goldenen
Schuss« im Fernseher sehen wollten, die früh aufstehen
mussten und nachts lärmempfindlich wurden, die manchmal in
der Kneipe nebenan saßen, im »Felsenkeller« am Tresen ihr Bier
tranken und dazu immer wieder unter eine von Fettfingerabdrücken
blinde Glasabdeckung griffen, um sich eine der alten,
harten, schwarzgebrannten Frikadellen vom Teller zu fischen,
die nur mit viel Senf genießbar waren, etwa im Verhältnis eins
zu eins.
NordPark Verlag
Literarische Texte und Texte zur Literatur
Die Titel des Nordpark-Verlages können über jede gute Buchhandlung bezogen werden.
Dort berät man Sie gern.
Sollte keine in Ihrer Nähe sein, schicken Sie Ihre Bestellung einfach an uns:
N o r d P a r k
V e r l a g
Alfred Miersch
Klingelholl 53
D-42281 Wuppertal
Tel.: 0202/ 51 10 89
Fax: 0202/29 88 959
E-Mail: miersch@nordpark-verlag.de
Webmaster: Alfred Miersch
 Cover ( 2.6 mb/pdf)
Cover ( 2.6 mb/pdf)